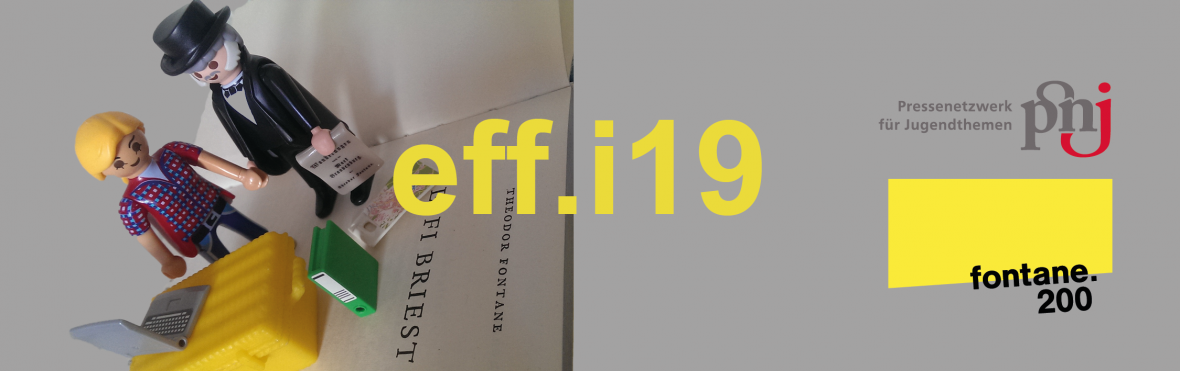Wie eine Fremdsprache lasen wir die ersten Worte von Effi Briest. Die langen Sätze bildeten ein verwirrendes Konstrukt, bei dem zu Anfang jeglicher Sinn fehlte. Allmählich gewöhnten wir uns an die blumige, altmodische Sprache, spätestens als Effi und ihre Mutter in der Szene auftauchten. Der quirlige Charakter des Mädchens war sofort erkennbar und weckte Sympathie für die Protagonistin. In dieser gehobenen Sprache durchlebten wir im Geist unseren alltäglichen Nachhauseweg. Wir stellten uns die Häuser, Straßen und Sinneseindrücke so genau vor, wie man es selten in der Routine wahrnimmt. So entstanden aus den wenigen Minuten von der Schule oder der Arbeit zum eigenen Zimmer ausführliche Texte. Sie schenkten den kurzen, sonst kaum beachteten Augenblicken am Tage ihren verdienten Wert.
 Das unüberhörbare Knistern des Laubes flüstert mir ein leises “Willkommen zurück” ins Ohr, während ich den schmalen grauen Weg am Rande der dicht befahrenen Kreuzung entlanggehe und die Musik meines Handys deutlich lauter drehe, um die Masse an Fahrzeugen zu übertönen, die dort durch den schweren, düsteren Oktobernebel rasen. Schon bald biege ich in eine scheinbar endlose Straße, meine Straße, ein und sogleich erstreckt sich vor mir eine eintönige Masse aus weißen und pastellgelben Häusern, alle tragen sie ein rotes oder braunes Dach und haben kleine Vorgärten mit kleinen Sträuchern, hinter denen meist ein Garagentor hervorlugt. Kleine Mauern oder graue Zäune mit wiederkehrenden Mustern markieren die Grenze jedes Grundstücks und wenn man es wagt, eines der Tore zu öffnen, wird man stets auf einem sauber gepflasterten Weg direkt vor eine Haustür getragen. In diesem eintönigen Chaos aus weißen und pastellgelben Häusern finde ich schließlich auch meines. Behutsam und doch genervt von meinem bisherigen Tag öffne ich das blaugraue Tor und betrete den bereits erwähnten sauber gepflasterten Weg, der mich zu der großen, dunkelgrünen Haustür führt, in deren Schloss ich nun meinen Hausschlüssel stecke und den warmen Hausflur betrete.
Das unüberhörbare Knistern des Laubes flüstert mir ein leises “Willkommen zurück” ins Ohr, während ich den schmalen grauen Weg am Rande der dicht befahrenen Kreuzung entlanggehe und die Musik meines Handys deutlich lauter drehe, um die Masse an Fahrzeugen zu übertönen, die dort durch den schweren, düsteren Oktobernebel rasen. Schon bald biege ich in eine scheinbar endlose Straße, meine Straße, ein und sogleich erstreckt sich vor mir eine eintönige Masse aus weißen und pastellgelben Häusern, alle tragen sie ein rotes oder braunes Dach und haben kleine Vorgärten mit kleinen Sträuchern, hinter denen meist ein Garagentor hervorlugt. Kleine Mauern oder graue Zäune mit wiederkehrenden Mustern markieren die Grenze jedes Grundstücks und wenn man es wagt, eines der Tore zu öffnen, wird man stets auf einem sauber gepflasterten Weg direkt vor eine Haustür getragen. In diesem eintönigen Chaos aus weißen und pastellgelben Häusern finde ich schließlich auch meines. Behutsam und doch genervt von meinem bisherigen Tag öffne ich das blaugraue Tor und betrete den bereits erwähnten sauber gepflasterten Weg, der mich zu der großen, dunkelgrünen Haustür führt, in deren Schloss ich nun meinen Hausschlüssel stecke und den warmen Hausflur betrete.
Luisa

Quietschend kommt der Zug zum Stillstand, mit einem Rauschen öffnen sich die Türen, die Passagiere steigen aus, eine von ihnen ist ein Mädchen. Der erste Schritt auf dem Bahnsteig ist ein Schritt in die altbekannte Welt. Sie blickt um sich, betrachtet einige Reisende, die mit ihrem Gepäck hantieren. Ein grauer Bahnhof, doch sauber, leer und groß, hinaus ins Weite kann sie schauen, wenn sie dem nächsten Zug bei der Ausfahrt mit dem Blick folgt.

Sie läuft mit schnellen Schritten die Treppe hinunter, andere stolpern, sind schwermütig, doch sie stürzt fast an ihnen vorbei, so sehr sehnt sie sich nach dem Ausgang. Die Treppe endet an einem weißen Fliesenboden, weiße Wände mit Plakaten, Abfahrtsinformationen, erleuchtet mit hellen LED-Lämpchen im Glaskasten. Sie geht vorbei an diesen Plakaten, sieht den neuen Dirigenten des Staatsorchesters auf einem der Bilder, dort spielt auch eine ehemalige Schulkameradin. Sie nimmt sich vor, wenigstens einmal ein Konzert dieses Orchesters zu besuchen. In der Bahnhofshalle angekommen, wandert die Decke höher, Tageslicht strömt hinein durch Fenster und Türen, deutsch-polnische Werbung an den Seiten, dessen Werbezweck sie nicht versteht, doch allein der Fakt, dass hier die Werbung zweisprachig erscheint, schmeckt nach Heimat.
 Die Türen öffnen sich für sie und sie tritt hinaus in den Abend. Die Busse halten und fahren an ihr vorbei. Sie tritt auf den gepflasterten Weg, einige Meter weiter ist der Arbeitsplatz ihres Vaters, versteckt in einem großen Haus mit einer Filmwerbetafel, die nur noch zur Hälfte funktioniert. Sie schlägt den Schleichweg ein, möchte heute nicht an der Hauptstraße entlang, sondern die Ecken und Winkel genießen. Ein hohes Denkmal sticht in den Himmel, während sie vom Bahnhofsberg hinab blickt. Vorbei an Ecken und Nischen steht eine Backsteinruine, umzäunt und verwiesen mit Warnschildern, bewachsen mit Efeu bis zum Dach, das schon bröckelt. Das ist also die Bahnhofsruine, denkt sie sich, diese Ruine nimmt sie zum ersten Mal bewusst wahr und es schließt sich der Kreis aus Erzählungen, eine Freundin von ihr hatte hier als Kind mit ihren Mitschülern gespielt, bis ein Ordnungshüter kam und sie sich verstecken mussten.
Die Türen öffnen sich für sie und sie tritt hinaus in den Abend. Die Busse halten und fahren an ihr vorbei. Sie tritt auf den gepflasterten Weg, einige Meter weiter ist der Arbeitsplatz ihres Vaters, versteckt in einem großen Haus mit einer Filmwerbetafel, die nur noch zur Hälfte funktioniert. Sie schlägt den Schleichweg ein, möchte heute nicht an der Hauptstraße entlang, sondern die Ecken und Winkel genießen. Ein hohes Denkmal sticht in den Himmel, während sie vom Bahnhofsberg hinab blickt. Vorbei an Ecken und Nischen steht eine Backsteinruine, umzäunt und verwiesen mit Warnschildern, bewachsen mit Efeu bis zum Dach, das schon bröckelt. Das ist also die Bahnhofsruine, denkt sie sich, diese Ruine nimmt sie zum ersten Mal bewusst wahr und es schließt sich der Kreis aus Erzählungen, eine Freundin von ihr hatte hier als Kind mit ihren Mitschülern gespielt, bis ein Ordnungshüter kam und sie sich verstecken mussten.
Die Straße führt steil hinab, ihre Schritte federn, rechts neben ihr eine Baustelle, auf der die Pflanzen die Macht übernehmen, auf der anderen Seite eine Häuserwand, an dessen Türklingeln selbst beschriebene und geklebte Namensschildchen hängen. Die Balkone gefüllt mit Rosen, Stiefmütterchen und Kräutern, abblätternde Farbe und Schmutzflecke als Spuren der langen Jahre. Am Ende dieser Straße steht ein neuartiges, graues Gebäude, der Dönerladen darin großflächig gepriesen. Doch sie interessiert sich nicht für die Geschäfte, sondern für das, was nach dem kleinen Einkaufsgebäude kommt – der Gertraudpark. Es ist nur eine Straße, die sie auch ohne nach links und rechts zu schauen überquert, heute zumindest, dann ist sie umgeben von Grün.
 Die Kirche mit ihrer goldenen Uhr zeigt die vergangenen Minuten seit ihrer Ankunft an, die Engel und Wesen aus Stein schauen herab mit leeren, doch schönen Gesichtern. Im Park sitzen junge und alte Menschen, die alten stützen sich auf ihren Rollatoren ab, die jungen, oft Pärchen aus der Universität, unterhalten sich angeregt. Das Gras bedeckt mit bunten Blättern, das Kleistdenkmal beschmückt mit Blumen und nach all den Jahren, die sie hier verbracht hatte, die sie an diesem Denkmal vorbei gegangen war, bemerkt sie er jetzt, dass dort Heinrich von Kleist auf dem Sockel posiert. Sie biegt ein in die Lindenstraße, dort liegen kistenweise Bücher aus, das Antiquariat hat noch für eine halbe Stunde geöffnet. Sie stöbert durch die Bücher, doch anders als letzte Woche liegen dort nur Groschenromane. Sie legt das letzte Buch zurück, schlendert weiter, vorbei an der Metallstatue, eine sich nach vorne beugende Frau mit einem verschwörerischen Lächeln und hohlen Augen. Auf dem Sockel steht: „Haus der Künste“. Ja, hier war das Mädchen vor nicht langer Zeit alle zwei Wochen gewesen, ist die knarzenden Stufen hinaufgegangen, hatte sich freudestrahlend auf einen der bunten Stühle gesetzt, in einer kleinen Runde Tee getrunken, Kekse gegessen und geschrieben. Doch diese Zeit war seit einigen Monaten vorüber, sie geht weiter, wartet an den Ampeln, schaut zum Oderturm hinauf, dessen leuchtende Buchstaben in der Nacht an einer Seite nur noch „Oderurm“ zeigten. Links von ihr ist die Lenné-Passage, und zusammen mit dem Oderturm bildet sie das Zentrum der Einkaufshallen von Frankfurt Oder. Der Markt ist noch geöffnet, hier verkaufen zwei polnische Frauen Obst und Gemüse, Straßenmusikanten spielen hier, oder engagierte Menschen verteilen Flyer. Das Mädchen kennt sie alle, sie hatte oft bei den Frauen eingekauft, oft genug gesagt, sie sei noch nicht 18 und könne deshalb keinen Spendenvertrag unterschreiben. Sie hatte den Straßenmusikanten immer Geld gegeben, meist spielte ein alter Mann irische Volksmusik, neben ihm sein Hund. Er hatte gelächelt, sich bedankt und einmal sogar „Bis morgen“ gesagt.
Die Kirche mit ihrer goldenen Uhr zeigt die vergangenen Minuten seit ihrer Ankunft an, die Engel und Wesen aus Stein schauen herab mit leeren, doch schönen Gesichtern. Im Park sitzen junge und alte Menschen, die alten stützen sich auf ihren Rollatoren ab, die jungen, oft Pärchen aus der Universität, unterhalten sich angeregt. Das Gras bedeckt mit bunten Blättern, das Kleistdenkmal beschmückt mit Blumen und nach all den Jahren, die sie hier verbracht hatte, die sie an diesem Denkmal vorbei gegangen war, bemerkt sie er jetzt, dass dort Heinrich von Kleist auf dem Sockel posiert. Sie biegt ein in die Lindenstraße, dort liegen kistenweise Bücher aus, das Antiquariat hat noch für eine halbe Stunde geöffnet. Sie stöbert durch die Bücher, doch anders als letzte Woche liegen dort nur Groschenromane. Sie legt das letzte Buch zurück, schlendert weiter, vorbei an der Metallstatue, eine sich nach vorne beugende Frau mit einem verschwörerischen Lächeln und hohlen Augen. Auf dem Sockel steht: „Haus der Künste“. Ja, hier war das Mädchen vor nicht langer Zeit alle zwei Wochen gewesen, ist die knarzenden Stufen hinaufgegangen, hatte sich freudestrahlend auf einen der bunten Stühle gesetzt, in einer kleinen Runde Tee getrunken, Kekse gegessen und geschrieben. Doch diese Zeit war seit einigen Monaten vorüber, sie geht weiter, wartet an den Ampeln, schaut zum Oderturm hinauf, dessen leuchtende Buchstaben in der Nacht an einer Seite nur noch „Oderurm“ zeigten. Links von ihr ist die Lenné-Passage, und zusammen mit dem Oderturm bildet sie das Zentrum der Einkaufshallen von Frankfurt Oder. Der Markt ist noch geöffnet, hier verkaufen zwei polnische Frauen Obst und Gemüse, Straßenmusikanten spielen hier, oder engagierte Menschen verteilen Flyer. Das Mädchen kennt sie alle, sie hatte oft bei den Frauen eingekauft, oft genug gesagt, sie sei noch nicht 18 und könne deshalb keinen Spendenvertrag unterschreiben. Sie hatte den Straßenmusikanten immer Geld gegeben, meist spielte ein alter Mann irische Volksmusik, neben ihm sein Hund. Er hatte gelächelt, sich bedankt und einmal sogar „Bis morgen“ gesagt.
Sie läuft schräg über den Parkplatz, um schneller nach Hause zu kommen, die Uhr der Marienkirche schlägt zur vollen Stunde, das Rathaus liegt noch vor ihr in seiner roten Backsteinpracht, doch nur wenige Meter später sieht sie den Turm des Rathauses und nicht mehr den Eingangsbereich.
Große, rechteckige Steine bilden den Fußweg, damals war sie gehüpft, um nicht die Rillen zwischen den Steinen zu betreten, heute tut sie das nicht mehr, doch sie läuft beschwingt.
 Sie muss grinsen, als sie die Treppen hinaufläuft, zwei Stufen auf einmal nehmend. Sie schließt die Tür auf, ruft laut Hallo in den Wohnungsflur hinein, stürmt auf ihre Mutter zu und umarmt sie, umarmt ihren Vater, ihre Schwester. Geht in ihr Zimmer, blickt auf das Rathaus, auf die goldene Uhr, die von den letzten Strahlen des Tages reflektiert wird – das Blau geht langsam in ein Grau über, sie blickt soweit ihre Augen reichen, am Museum Viadrina vorbei, und wenn sie sich konzentriert, die Augen zusammen kneift – dann kann sie am Horizont die Oder sehen. Die Oder – nur wenige Minuten entfernt, ein stiller Fluss, Grenze und Verbindung zu einem anderen Land. Ein stiller Fluss, der durch zwei stille Städte fließt.
Sie muss grinsen, als sie die Treppen hinaufläuft, zwei Stufen auf einmal nehmend. Sie schließt die Tür auf, ruft laut Hallo in den Wohnungsflur hinein, stürmt auf ihre Mutter zu und umarmt sie, umarmt ihren Vater, ihre Schwester. Geht in ihr Zimmer, blickt auf das Rathaus, auf die goldene Uhr, die von den letzten Strahlen des Tages reflektiert wird – das Blau geht langsam in ein Grau über, sie blickt soweit ihre Augen reichen, am Museum Viadrina vorbei, und wenn sie sich konzentriert, die Augen zusammen kneift – dann kann sie am Horizont die Oder sehen. Die Oder – nur wenige Minuten entfernt, ein stiller Fluss, Grenze und Verbindung zu einem anderen Land. Ein stiller Fluss, der durch zwei stille Städte fließt.
Swantje
 Der Wind, der immer wieder sanft durch die Baumkronen der Bäume entlang der Karl-Liebknecht-Straße wehte, brachte die inzwischen nicht mehr ganz so vielen grünen, gelben und leicht orangefarbenen Blätter zum Klingen, die selbst in dem Hupen und Quietschen der Autoreifen, wenn sie an der Ampel hielten, zu hören waren und den Herbst ankündigten, denn immer wieder fiel ein einzelnes Blatt auf das historische Kopfsteinpflaster und den Asphalt, wobei das noch warme Sommersonnenlicht auf die Silhouette eines Mädchens fiel, dessen offenes Haar im Sonnenschein seidig schimmerte, und das den gepflasterten Gehweg neben der viel befahrenen Straße unter den Baumkronen der Bäume, die zur Straße hin standen, mit ihrem Fahrrad, vorbei an wilhelminischen Häusern munter entlangfuhr, froh, dass die Schule zu Ende war, ab und an mit dem Rad über einen losen Stein oder eine Senkung des Gehweges wobei ihr Ranzen auf ihrem Rücken dann immer einen Hopser machte.
Der Wind, der immer wieder sanft durch die Baumkronen der Bäume entlang der Karl-Liebknecht-Straße wehte, brachte die inzwischen nicht mehr ganz so vielen grünen, gelben und leicht orangefarbenen Blätter zum Klingen, die selbst in dem Hupen und Quietschen der Autoreifen, wenn sie an der Ampel hielten, zu hören waren und den Herbst ankündigten, denn immer wieder fiel ein einzelnes Blatt auf das historische Kopfsteinpflaster und den Asphalt, wobei das noch warme Sommersonnenlicht auf die Silhouette eines Mädchens fiel, dessen offenes Haar im Sonnenschein seidig schimmerte, und das den gepflasterten Gehweg neben der viel befahrenen Straße unter den Baumkronen der Bäume, die zur Straße hin standen, mit ihrem Fahrrad, vorbei an wilhelminischen Häusern munter entlangfuhr, froh, dass die Schule zu Ende war, ab und an mit dem Rad über einen losen Stein oder eine Senkung des Gehweges wobei ihr Ranzen auf ihrem Rücken dann immer einen Hopser machte.
An der Kreuzung stand ein großes, gelbes, stuckverziertes Mehrfamilienhaus, in dem acht Wohnungen enthalten waren und diagonal gegenüber einem etwas helleren, gelben Mehrfamilienhaus stand, das zwar von der gleichen Person erdacht worden war, aber nicht einmal annähernd so schön war wie jenes, an dessen kleinem, eingezäunten Vorgarten das Mädchen mit dem Fahrrad vorbeigefahren war und nun an der Ecke abbog, an dem ehemaligen Laden, der sich vor langer Zeit im Erdgeschoss des Hauses Nummer 65 Ecke Friedrich-Hebbel-Straße befand, vier Meter weiter langsamer wurde, in einer kleinen Senkung, welche die Auffahrt darstellte, den Fuß auf die vergitterte Tür abstellte, die mit einem ebenso vergitterten Tor verbunden war, an der rechten Seite der Tür ein verwittertes, verrostetes Schild „Privatgrundstück! Betreten verboten!“ Das Mädchen, ihr Name war übrigens Henriette, stieß mit einer Hand das Tor auf und fuhr in den sandigen Hof nach rechts auf den roten, gepflasterten Fahrradplatz und galant in den Fahrradständer mit sehr viel Schwung hinein.
 Nachdem Henriette ihr Fahrrad abgeschlossen hatte, zurück durch das Tor, um die Ecke herum, und an dem kleinen Vorgarten vorbei gegangen war, öffnete sie den weißen Briefkasten, nahm den Inhalt heraus und schloss die einst mit Graffiti besprühte weiß-grüne Holztür auf, trat dann in den kühlen Flur ein, dessen Wände mit dunkelgrüner Farbe bestrichen war, ging ein paar Meter weiter, um dann eine doppelseitige Schwingtür aufzustoßen und die Treppe in den ersten Stock hinauf, um die linke Wohnungstür zu nehmen, welche sie aufschloss und die Wohnung betrat, ihre Mappe auf die große Truhe neben der Tür stellte, in die Küche ging, den Tiefkühlschrank öffnete, sich aus der untersten Schublade eine Schokoeistüte nahm, die Verpackung entfernte und freudig genoss, wie das wohltuende, kühle Eis auf ihrer Zunge zerschmolz.
Nachdem Henriette ihr Fahrrad abgeschlossen hatte, zurück durch das Tor, um die Ecke herum, und an dem kleinen Vorgarten vorbei gegangen war, öffnete sie den weißen Briefkasten, nahm den Inhalt heraus und schloss die einst mit Graffiti besprühte weiß-grüne Holztür auf, trat dann in den kühlen Flur ein, dessen Wände mit dunkelgrüner Farbe bestrichen war, ging ein paar Meter weiter, um dann eine doppelseitige Schwingtür aufzustoßen und die Treppe in den ersten Stock hinauf, um die linke Wohnungstür zu nehmen, welche sie aufschloss und die Wohnung betrat, ihre Mappe auf die große Truhe neben der Tür stellte, in die Küche ging, den Tiefkühlschrank öffnete, sich aus der untersten Schublade eine Schokoeistüte nahm, die Verpackung entfernte und freudig genoss, wie das wohltuende, kühle Eis auf ihrer Zunge zerschmolz.
Henriette
Fotos: flickr